» Veröffentlicht am
28. Juli 2023
Eine Lehrkooperation über Disziplin- und Hochschulgrenzen hinweg? Dank digitaler Tools kein Problem!
Kann digitales Lehren und Lernen über Disziplin- und
Hochschulgrenzen hinweg funktionieren? Die Antwort ist ja! Und dies ist
weniger aufwendig als gedacht: Die Schaffung digitaler und
hochschulübergreifender Lehr-Lern-Settings bedarf lediglich die
Verwendung einiger weniger Online-Tools sowie guter Planung und
Vorbereitung.
Ein Beitrag von Alessa Schuldt
Um künftige Lehrkräfte auf die berufsgruppenübergreifende Kooperation
mit anderen pädagogischen und sozialen Professionen bereits während der
universitären Ausbildung vorbereiten zu können, wird im Rahmen von BiProfessional1,
dem Bielefelder Standortprojekt der von Bund und Ländern finanzierten
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ regelmäßig das Seminarangebot „Multiprofessionelle Kooperation in inklusiven Ganztagsschulen“
angeboten. Da die Potenziale der multiprofessionellen Kooperation in
der Schulpraxis oftmals nicht hinreichend ausgeschöpft werden, weil es
Lehrkräften u.a. an Wissen über die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche
sowie die Kompetenzen anderer Berufsgruppen mangelt, ist es uns ein
wichtiges Anliegen, im Zuge multiprofessionell ausgerichteter
Lehrveranstaltungen frühzeitig einen Kontakt zwischen
Lehramtsstudierenden und Vertreter*innen anderer pädagogischer und
sozialer Professionen herzustellen und die Diskurse zu den Themen
Inklusion und Ganztag zusammenzuführen. Damit aber nicht nur die
Studierenden hier vor Ort in Bielefeld, sondern auch an anderen
Hochschulen von unserem innovativen Lehrkonzept und der umfangreichen
Materialsammlung profitieren können, haben wir uns aktiv darum bemüht,
mit Lehrenden und Studierenden anderer Standorte, wie z.B. der
Universität Siegen und der Hochschule Nordhausen, zusammenzuarbeiten.
Leichter gesagt als getan!
Denn unsere Transferbemühungen fielen tatsächlich genau in die
Zeit der Corona-Pandemie. So war es alles andere als leicht, Kontakte
mit Lehrenden anderer Institutionen zu knüpfen, geschweige denn sie
davon zu überzeugen, eine gemeinsame digitale Lehrveranstaltung mit uns
durchzuführen.
Im ersten Corona-Winter organisierte ich gemeinsam mit
einigen Kolleg*innen der Universität Kassel einen Online-Workshop zum
Thema „Team Teaching in der Hochschule“ und warb für unser Lehrkonzept
um potentielle Mitstreiter*innen jenseits der Bielefelder Uni. Hier
lernte ich Prof. Dr. Markus Sauerwein kennen – oder sollte ich besser
sagen, die schlechte Internetverbindung von Markus an jenem Tag. Eine
Baustelle vor der Haustür lies sein Videobild immer wieder einfrieren
und schmiss ihn mehrere Male aus dem Zoom-Meeting. Keine ideale
Ausgangslage für den Aufbau einer gemeinsamen Lehrkooperation, aber
Markus ließ sich davon zum Glück nicht abschrecken und wir verabredeten
uns erneut per Zoom, um gemeinsame Interessen und die jeweiligen
Rahmenbedingungen an unseren Hochschulen auszuloten. An diesem Tag
funktionierte die Internetverbindung einwandfrei und wir legten den
Grundstein für unsere kollegiale Kooperation.
Circa ein Jahr und
einen Hochschulwechsel später (Markus wechselte von der Fliedner FH in
Düsseldorf an die Hochschule Nordhausen in Thüringen), war es dann
endlich soweit: Wir gingen in die konkrete Feinplanung unserer
gemeinsamen Lehrveranstaltung im Wintersemester 2022/23. In der
Zwischenzeit komplementierten Annalena Danner (wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Hochschule Nordhausen) und Manfred Palm (Lehrer im
Hochschuldienst an der Universität Bielefeld) unser Lehrenden-Team und
das gemeinsame Seminarangebot wurde an beiden Standorten für eine
Vielzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen geöffnet (s. Abb. 1).
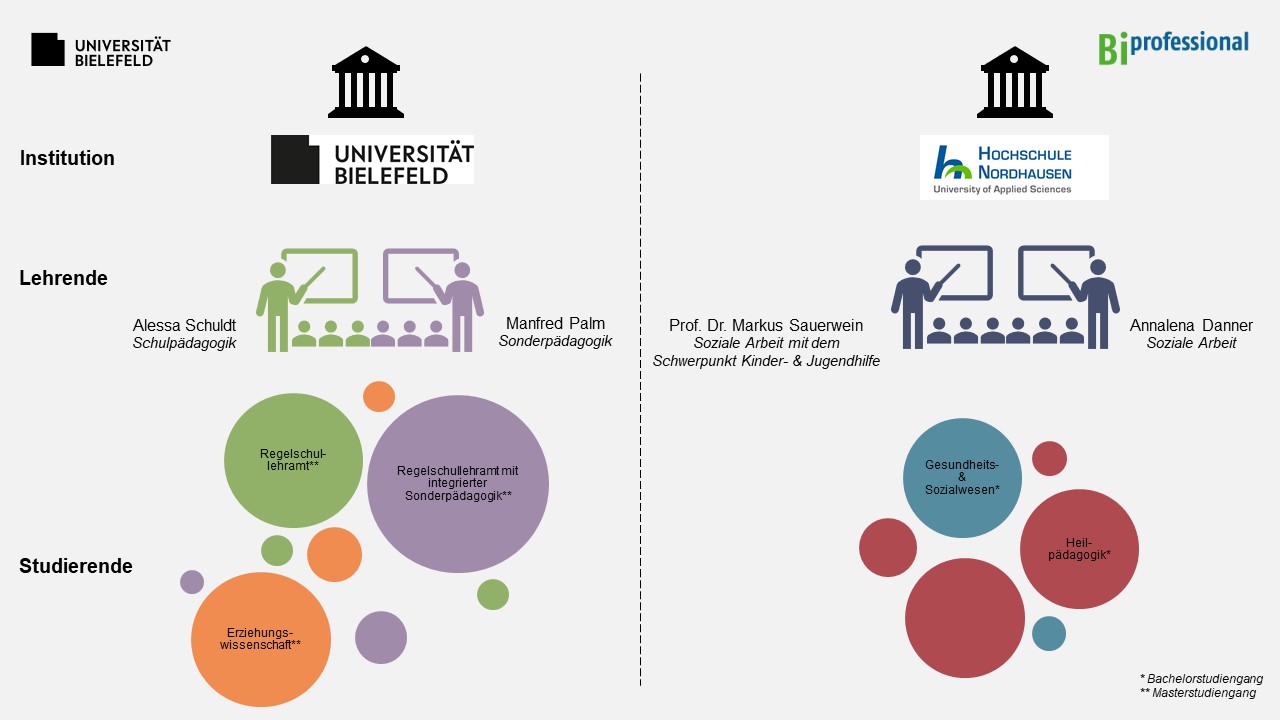
Abbildung 1: Schematische Darstellung des multiprofessionellen Lehr-Lern-Settings (eigene Darstellung) Grafik: Alessa Schuldt
Aller Anfang ist bzw. war schwer.
Die
anfängliche Idee einer gemeinsamen Blockveranstaltung, bei der Lehrende
und Studierende sich gegenseitig an den verschiedenen Standorten
besuchen, musste allerdings aufgrund fehlender Exkursionsmittel schnell
ad acta gelegt werden. Auch das Blockformat stand anfänglich auf der
Kippe, da beide Hochschulen zunächst ein wöchentliches Format verlangten
und feste Zeitfenster vorgaben. Schließlich ließ sich aber eine Art
Mischformat (s. Abb. 2) realisieren: So starteten wir zunächst – jeder
Standort für sich – mit wöchentlichen Inputveranstaltungen, die
unabhängig voneinander und zu verschiedenen Themenschwerpunkten
durchgeführt wurden. Zur Mitte der Vorlesungszeit fand dann der erste
gemeinsame Block im Sinne einer gemeinsamen Kick-Off-Veranstaltung
statt, die die hochschulübergreifende Projektphase einläuten sollte.
Dafür teilten sich die Studierenden in Kleingruppen auf, in denen eine
berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit anhand von Fall- oder
Konzeptarbeit simuliert werden sollte. Diese Arbeitsphase fand
ausschließlich digital statt und wurde von den Studierenden
weitestgehend selbstständig organisiert. Den Abschluss des gemeinsamen
Veranstaltungsblocks markierte die Ergebnispräsentation Mitte Januar
2023. Für die Umsetzung der gemeinsamen digitalen Meetings, musste
lediglich auf einige wenige Online-Tools zurückgegriffen werden: So
wurde zum einen Zoom für die Durchführung der Blockveranstaltungen und
das kollaborative Arbeiten in den Kleingruppen genutzt. Zum anderen
verwendeten wir ein GoogleDoc zum Austausch der Kontaktdaten sowie ein
Padlet für die Bereitstellung von Materialien und Aufgabenstellungen.
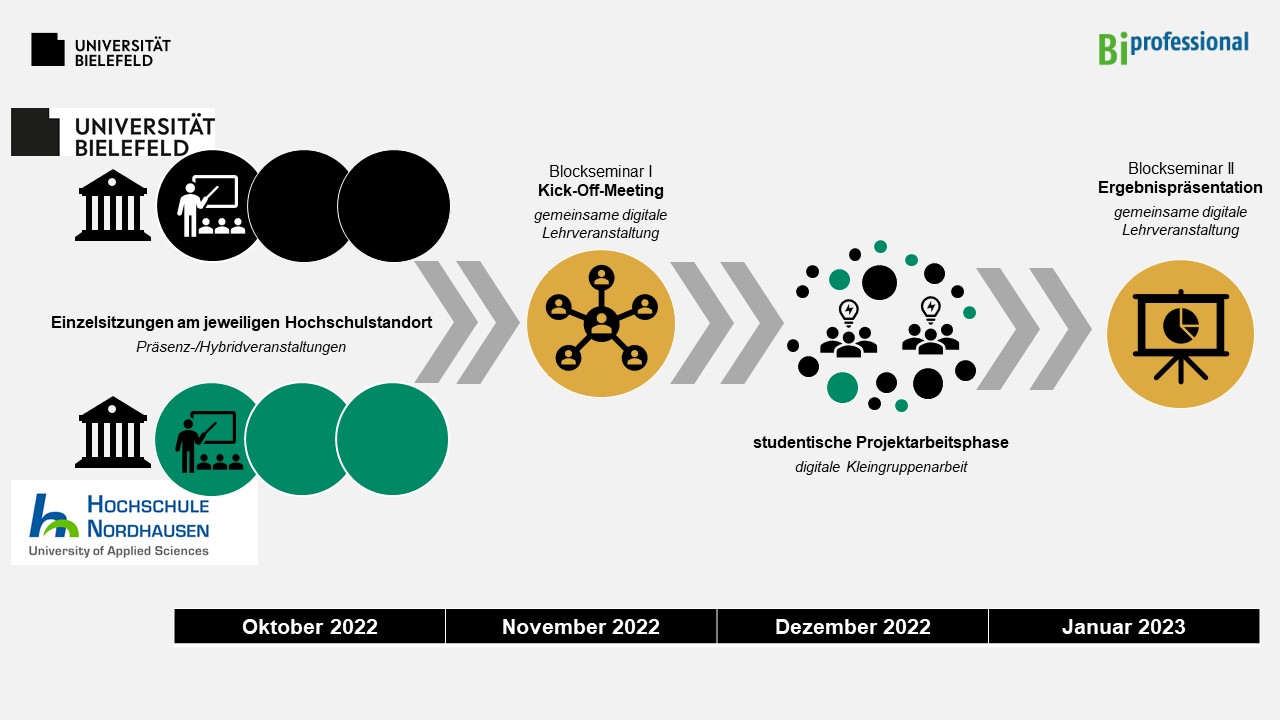
Abbildung 2: Aufbau und zeitlicher Ablauf der gemeinsamen Lehr-Lern-Kooperation Grafik: Alessa Schuldt
Als Unterstützungsangebot boten wir den Kleingruppen digitale
Sprechstunden an. Allerdings benötigten die Studierenden anscheinend gar
keine Form der Hilfe. Alle Gruppen waren arbeitsfähig und erarbeiteten
Ergebnisse, die sich vor allem durch ihre hohe Qualität auszeichneten.
Zudem waren wir Lehrenden absolut begeistert von der digitalen
Aufbereitung und Präsentation der Arbeitsergebnisse. Wirklich jedes
einzelne Gruppenmitglied übernahm eine kurze Sprech- und
Vorstellungsaufgabe während der digitalen Ergebnispräsentation, obwohl
wir dies so vorab gar nicht eingefordert hatten. (Darüber hinaus hatten –
bis auf zwei an Corona erkrankte Teilnehmer*innen, die auf eigenen
Wunsch und trotz Krankheit unbedingt an der Vorstellungsrunde teilnehmen
wollten – alle ihre Kamera an. 😉)
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Rückblickend
betrachtet war die digitale Lehr-Lern-Kooperation ein absoluter Gewinn
für alle Beteiligten, auch wenn die Vorbereitung doch so einiges an Zeit
verschlang und vor allem Annalena und mir recht viel an
vorausschauender Organisation abverlangte. Diese nahmen wir aber
letztlich gerne in Kauf, weil wir immer die Vorteile unserer Kooperation
klar vor Augen hatten und die Studierenden unterschiedlicher
pädagogischer Fachrichtungen miteinander in den Austausch bringen
wollten. Dieser war auch für die Studierenden nicht immer einfach, wie
ein abschließendes Reflexionsgespräch offenbarte. Dies lag aber eher
weniger an schlechten Internetverbindungen als an zum Teil sehr
unterschiedlichen pädagogischen Standpunkten bzw. Sichtweisen sowie an
der Einsozialisierung in verschiedene Berufsfelder und -kulturen. Umso
schöner, dass unser gemeinsames Lehrprojekt die Studierenden hierfür
sensibilisieren und somit vielleicht auch ein bisschen besser auf
mögliche Herausforderungen der multiprofessionellen Kooperation in der
Praxis vorbereiten konnte.
Aber auch für uns Lehrende war die
Kooperation sehr lohnenswert und hat enorm zur Weiterentwicklung des
Konzepts und der Arbeitsmaterialien beigetragen. Darüber hinaus haben
Manfred und ich, die beiden „Lehrenden“ im Team, zwei tolle neue
Kolleg*innen aus dem Bereich der Sozialpädagogik sowie ihre umfassende
Expertise für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu schätzen
gelernt. Diese Verbindung wird hoffentlich noch lange anhalten und eine
Lehrkooperation bei nächster Gelegenheit wiederholt werden. Denn durch
unsere gute „Vorarbeit“ dürften die kommenden Lehrprojekte mit deutlich
weniger Vorbereitungszeit zu meistern sein. Und wer weiß, vielleicht
treffen wir vier uns dann ja auch das erste Mal persönlich – ganz ohne
instabile Internetverbindungen im Zoom.
Das Lehrkonzept und
die digitale Kooperation zwischen Lehrenden und Studierenden der
Universität Bielefeld und der Hochschule Nordhausen wurde im Mai 2023
vom Stifterverband mit der Hochschulperle des Monats ausgezeichnet. Weitere Informationen
Interesse am Seminarkonzept oder am kollegialen Austausch?
Kontaktadresse:
Alessa Schuldt
Wiss. Mitarbeiterin
E-Mail: alessa.schuldt@uni-bielefeld.de
Kooperationsseminar: „Multiprofessionelle Kooperation in inklusiven Ganztagsschulen“
Tel.: 0521 – 106 3130
1 Das diesem Blog-Beitrag zugrundeliegende Vorhaben wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1908 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin des Beitrags.
»
Weiterlesen