» Veröffentlicht am
2. Februar 2023
Autoethnografische Notizen als Zugang zum eigenen Lehren und Lernen
Ein Beitrag von Björn Stövesand, Isabell Tacke und Samuel Albers
“Pustekuchen, oft hat man dann kein Bild, keinen Ton, stellt Fragen in das schwarze digitale Nichts vieler Namen.”
Das leidliche Thema der ausgeschalteten Kameras in Zoom: Ein
Phänomen, das seit Beginn der Online-Semester für die meisten Lehrenden,
aber auch Studierenden zum Alltag gehört und unterschiedlichste
Reaktionen hervorruft. Lehrende empfinden es als unangenehmes Hemmnis
der Lehrsituation, Studierende erleben vor allem in Gruppenarbeiten
holprige Interaktionen. Die Herausforderung und die Gefahr, dass sich
vorschnelle Urteile einschleichen oder sich Verdruss breit macht, ist
für alle gleichermaßen groß. Dabei sind es genau solche ‘neuen’
Konstellationen eigentlich vertrauter Situationen, wie dem
Seminargespräch, die zum Nachdenken anregen: Was ist eigentlich das
‘Neue’? Warum habe ich dieses oder jenes Gefühl dabei? Warum irritiert
mich das so? Um Antworten auf solche Fragen zu finden, ist eine
Beobachterposition erforderlich, von der aus – ohne Handlungsdruck –
analysiert werden kann, wie sich eine solche Situation abspielt und wie
mitunter emotionale Eindrücke entstehen.
Ein solches wissenschaftliches Vorgehen haben wir in der AG
Sprachdidaktik (Prof. Dr. Friederike Kern) mithilfe der Autoethnografie
eingeführt, mit der wir selbst, aber auch die Studierenden einen
distanzierten Blick auf das digitale Lehren und Lernen an der
Universität werfen können. Dazu wird das alltägliche Erleben in diesem
Bereich schriftlich festgehalten: Durch das bewertungs- und
interpretationsfreie Dokumentieren in Form von Tagebucheinträgen
entsteht nach und nach eine Textsammlung, die das ‘Lesen des Alltags’
ermöglicht - eine Strategie, mit der man zum Fremden im eigenen Leben
wird. Wer schon mal einen jahrealten Tagebucheintrag von sich selbst
gelesen hat, kennt diesen Effekt.
Durch die Förderung des Qualitätsfonds Lehre des ZLL konnten wir ein
kleines Lehr-Forschungsprojekt durchführen, in dem Studierende unserer
Seminare, die alle das Lehramt anstreben, ihren (digitalen) Lernalltag
jeweils über ein Semester hinweg als autoethnografische Protokolle in
Form von individuellen Tagebüchern dokumentieren.
Anschließend wurden die Studierenden von unserem ‘Analysetutor’ Samuel
Albers dabei unterstützt, die Protokolle aus einer wissenschaftlichen
Perspektive ‘neu’ zu lesen und so den eigenen Alltag zu einem
Forschungsgegenstand zu machen - mit besonderem Fokus auf Fragen der
Kommunikation und Wahrnehmung im digitalen Seminar.
Samuel stellt im Folgenden den konkreten Ablauf des Projekts und der
Analysegruppen vor.
Der wissenschaftliche Blick auf das eigene Lernen (Samuel Albers)
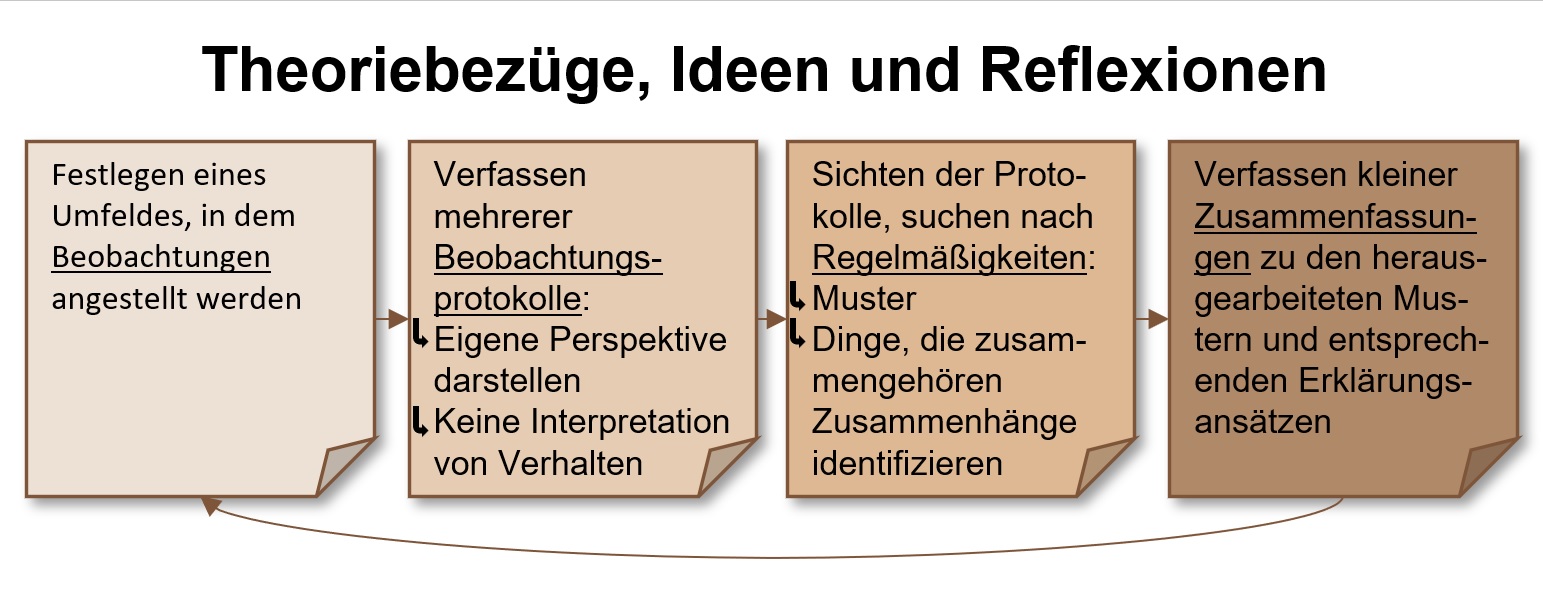
Die
Beobachtungen sollten im Umfeld des eigenen Lernens und Arbeitens im
digitalen Studium während der Pandemie angestellt werden – der konkrete
Fokus war dabei völlig offen, die Studierenden sollten sich von den
eigenen Interessen leiten lassen. In kleinen Gruppen habe ich als
‘Analysetutor’ mit den Studierenden in einer ungezwungenen Atmosphäre
regelmäßig die erstellten Beobachtungsprotokolle gesichtet und zunächst
daran gearbeitet, dass diese den Anforderungen nach Wert- und
Interpretationsfreiheit entsprechen. Wichtig war dabei auch, dass die
Protokolle einen hohen Detailgrad aufweisen, denn je umfangreicher eine
Beschreibung, desto besser für die Analyse.
Nach diesen Phasen wurden die Protokolle analytisch in den Blick
genommen. Das heißt, sie nach Themen, Mustern und Phänomenen zu
durchsuchen, die immer wieder auftauchen und daher offensichtlich im
Lernalltag der Teilnehmenden eine zentrale Rolle spielen. Sobald die
Studierenden eine Reihe solcher Muster und Themen identifiziert hatten,
ging es darum, theoretische Bezüge herzustellen. So konnten die
Studierenden die Chronologie des protokollierten Geschehens aufbrechen,
in eine thematische Ordnung überführen und so die Beschreibungen
interpretierend anreichern. Eine besondere Bedeutung kam dabei der
Diskussion der Protokolle in Gruppen zu, da gegenseitige Impulse,
Rückfragen und Thesen einen größeren Fremdheitseffekt ermöglichen.
Eine Teilnehmende berichtet folgendermaßen von ihrer Projektarbeit:
„Die größte Herausforderung ist es für mich gewesen, mein
Blickfeld nicht von vornherein einzuschränken und offen für alles zu
sein. So hat man in Dingen, die im ersten Moment als unwichtig oder
normal erschienen, beim zweiten Hinschauen eine Relevanz erkennen
können. Zudem war das dokumentieren nicht ganz so einfach. Eine weitere
Herausforderung für mich war es, das Erlebte beim Nacherzählen nicht
direkt schon zu analysieren und zu deuten, sondern erstmal wirklich nur
das Erlebte aufzuschreiben und dann in einem zweiten Schritt zu
analysieren.“
Den Arbeitsprozess mit den Protokollen und ihr Analyseergebnis zu
einem ausgewählten Thema haben die Studierenden dann in Form eines
wissenschaftlichen Posters präsentiert, was zugleich als benotete
Prüfungsleistung für ein Seminar der sprachlichen Grundbildung genutzt
werden konnte. Isabell Tacke hat selbst an dem Projekt teilgenommen und
stellt ihr Projekt kurz vor.
Ein Beispiel: Reflexion über die gegenseitige Wahrnehmung in Online-Seminaren (Isabell Tacke)
„… besonders in diesem Seminar fällt mir auf, dass nur die
Student*innen sich beteiligen, die auch ihre Kamera eingeschaltet haben.
[…] Ich stehe schnell aus dem Bett auf und nehme meinen Laptop und das
IPad wieder mit an den Schreibtisch, um meine Kamera anschalten zu
können. Die Dozentin beginnt […] das Meeting und startet mit einer
Wiederholung der Aufgaben. Ich schalte meine Kamera wieder aus und gehe
in die Küche, um mir etwas zum Frühstück zu machen.“
Eine Situation, wie diese haben bestimmt viele Student*innen in den
letzten Coronasemestern erlebt. Sich mit eingeschalteter Kamera zu
Zoom-Sitzungen hinzuzuschalten, ist immer wieder eine Hürde. Aber auch
das Teilnehmen an universitären Veranstaltungen, wie einer Vorlesung,
von sehr privaten Orten wie dem eigenen Bett aus, sind neue Phänomene,
welche bei mir immer wieder zu Unwohlsein geführt haben. Sitzen alle
Student*innen in ihrem privaten Umfeld vor ihrem Laptop oder PC, dann
ist außerdem das Ablenkungspotenzial sehr viel höher, als in
Vorlesungsräumen. So kann es passieren, dass ich online im Meeting als
schwarze Kachel anwesend bin, eigentlich jedoch gerade nebenan ein
Frühstück vorbereite, wie in meinem Protokollauszug festgehalten. Das
alles sind Phänomene, die plötzlich im Alltag der Lehrenden und
Lernenden eine Rolle spielen. Es sind kaum Seminargespräche möglich,
noch ist eine Anwesenheitskontrolle sinnvoll und durch das hohe
Ablenkungspotenzial fällt es mir deutlich schwerer mich auf die Inhalte
zu konzentrieren.
Um diese alltäglichen Herausforderungen überhaupt als solche in den
Blick nehmen zu können, bietet es sich an eine Beobachtungshaltung
einzunehmen.
Um mich diesem Eindruck zu nähern habe ich meine seit Wochen gesammelten
Tagebucheinträge nach Auffälligkeiten untersucht.
Mir fiel auf, dass es in der Präsenzlehre bisher so gewesen war, dass es
nur einen privaten und einen öffentlichen Raum gegeben hat. Während die
Lehre allgemein im öffentlichen Raum, also an Schulen oder
Universitäten stattgefunden hat, war der private Raum, also die eigenen
vier Wände, für das individuelle Arbeiten und die Freizeit reserviert.
Aus meinen Tagebucheinträgen ging hervor, dass ich mich immer dann
unwohl gefühlt hatte, wenn sich mein privater Raum zu sehr mit dem
öffentlichen Raum vermischte.
Durch die Umstellung zur Online-Lehre kommt nun ein weiterer Raum hinzu,
der „halb-öffentliche Raum“. Er wird durch einen Laptop oder Computer
und eine Videokonferenzsoftware von zuhause aus betreten. Gleichzeitig
wird in diesem Raum nun aber auch gelehrt, was bisher immer im
öffentlichen Raum, an Schulen oder Universitäten stattgefunden hat. Es
entsteht also ein neuer Raum, der sowohl sehr öffentlich als auch sehr
privat ist.
Dieser neue Raum ist weitgehend unbekannt und unreflektiert, sodass
große Unsicherheit herrscht, welches Verhalten dort akzeptiert wird und
was nicht in diesen Raum gehört.
Es entstehen viele Verhaltensweisen und Missverständnisse dadurch, dass
versucht wird, die gesellschaftlichen Regeln, auf die sich im Laufe der
Zeit geeinigt wurde, aus dem öffentlichen Raum auch im
„halb-öffentlichen-Raum“ anzuwenden. Die Öffentlichkeit dieses
Zwischenraums wird vor allem deswegen zum Problem, da ein
Präsentationszwang der eigenen Person entsteht. Ein Beispiel, was diesen
Gedanken verdeutlicht: Ich würde eigentlich nicht nur mit einem
Jogginganzug bekleidet an Veranstaltungen in der Universität teilnehmen.
Diese Verhältnisse zwischen dem privaten und öffentlichen Raum sind in
diesem Schaubild dargestellt:
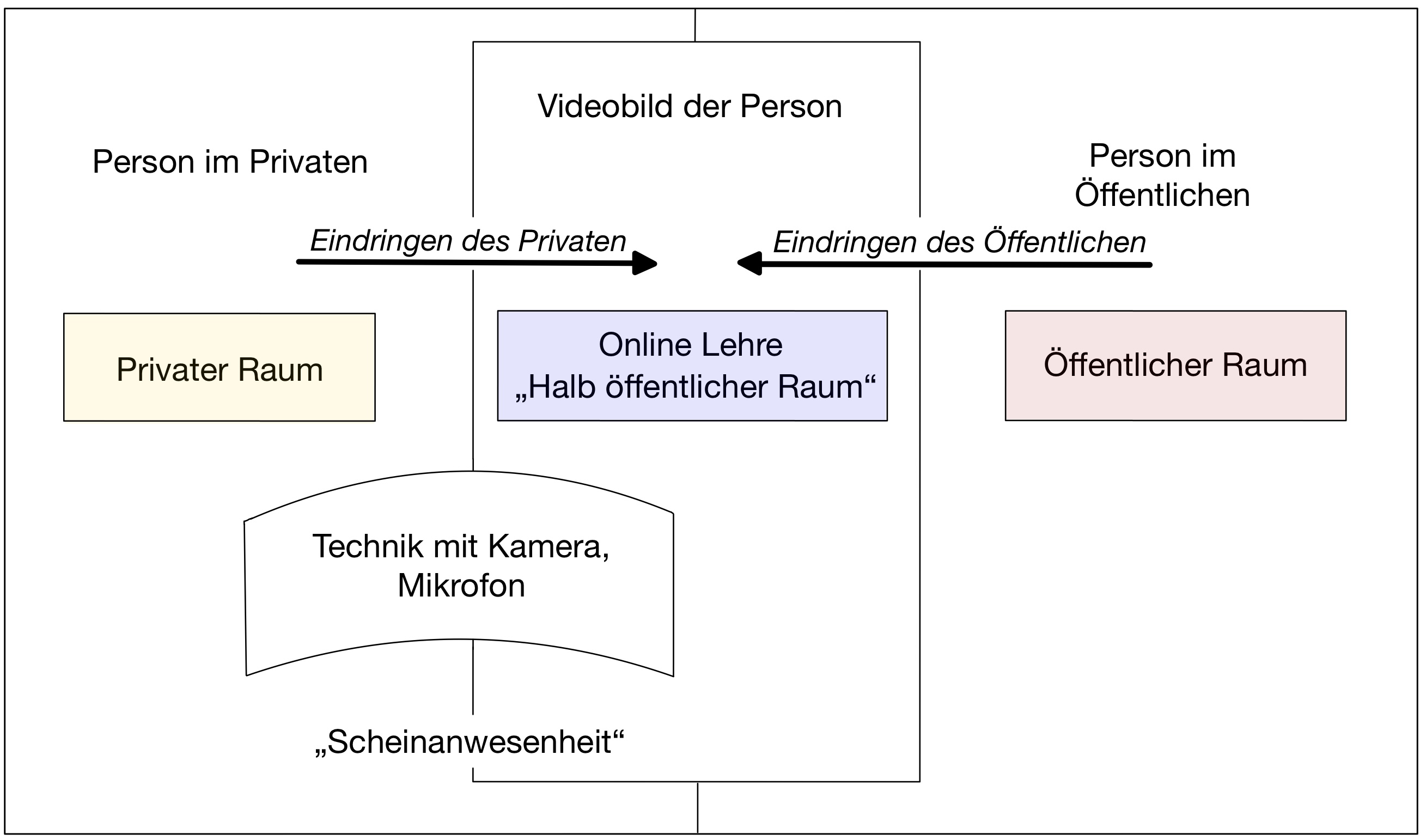
Als ich mir all dies herausgearbeitet hatte, konnte ich mir auf
einmal viele Phänomene und Schwierigkeiten der Online-Lehre ganz einfach
erklären.
So denke ich, dass jede Situation, in der sich der private Raum zu sehr
mit dem öffentlichen mischt zu Unwohlsein und Irritation bei Lehrenden
sowie Lernenden führt. Oft ist die Reaktion der Lernenden auf diese
Vermischung das Ausschalten der Kameras. Dieses Ausschalten ist ein
Symbol für den Rückzug in ihren privaten Raum und das Vermeiden von zu
großer Vermischung beider Räume. Damit verbunden ist auch das Phänomen
der „Scheinanwesenheit“, also die scheinbare Anwesenheit von Lernenden
durch schwarze Kacheln im Zoom-Meeting.
Das Ablenkungspotenzial im eigenen Arbeitszimmer ist deutlich höher als
im universitären Seminarraum. Der halb-öffentliche Raum wird so zur
ständigen Herausforderung, die Aufmerksamkeit auf die Veranstaltung
beizubehalten.
Daraus folgt auch, dass ich dem ortsunabhängigen Arbeiten und Lernen
nicht mehr uneingeschränkt positiv gegenüber stehe - die Raumvermischung
verlangt mir deutlich mehr ab, als es zunächst den Anschein hatte.
All diese Erkenntnisse und auch eine Einordnung in den
wissenschaftlichen Kontext habe ich auf einem Plakat zusammengefasst und
Konsequenzen abgeleitet:
- Persönliche Konsequenzen der Reflexion
Wenn ich in Zukunft also in einem Online-Seminar sitze und mich nicht
überwinden kann meine Kamera einzuschalten, weiß ich, dass es vermutlich
an der Vermischung des öffentlichen und des privaten Raums liegt. Ich
kann dann Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel das Einstellen des
verschwommenen Hintergrunds.
- Konsequenzen für Lehrende
Vielleicht noch wichtiger ist die Reflexion für diejenigen, die online
lehren. Für sie könnte es sinnvoll sein, die Schwierigkeiten der
Online-Lehre zu thematisieren, um vorschnellen Bewertungen des
Verhaltens zu entgehen. Zum Beispiel könnte man vorgeben, dass jeder
sich eine Ecke in seinem privaten Raum als Online-Ecke einrichtet und
vielleicht einen passenden Hintergrund einstellt.
Fazit
Das Projektbeispiel zeigt, wie eine distanzierte Beschäftigung mit
dem eigenen Alltag diffuse Emotionen und Affekte aufdecken und
bearbeitbar machen kann. Durch theoretische Bezüge und das Benennen von
Eindrücken und Phänomenen konnte Isabell im Projekt eine
Beschreibungssprache finden, die zu interessanten Reflexionen geführt
hat. Die Fähigkeit, sich von den eigenen Reaktionen und der
Involviertheit in Situationen zu lösen und sich sozusagen in die
Situation eines “Fremden” zu begeben, wird vor allem auch für angehende
Lehrkräfte als wichtiger Teil der Professionalität diskutiert. Aus
diesem Grund sind wir dabei, das Lehrprojekt zur Autoethnografie auch in
anderen Veranstaltungen rund um die Praxisphasen im Lehramtsstudium zu
implementieren.
»
Weiterlesen